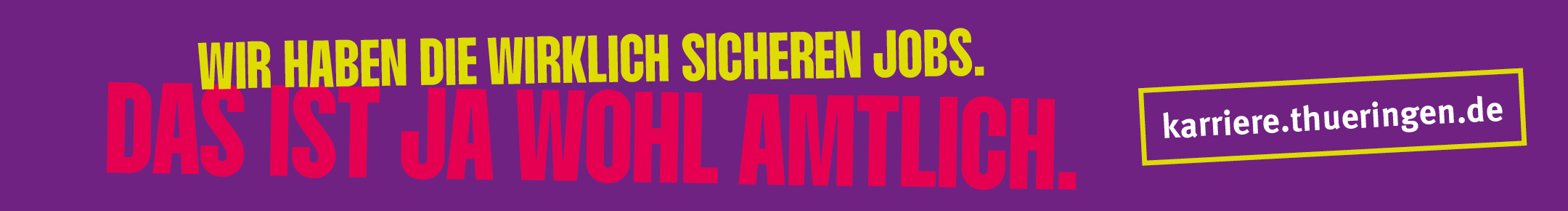Lesedauer: 5 Minuten
Hochschule Schmalkalden (HSM)
Hochschule Schmalkalden (HSM): Freie Fahrt für heiße Schmelze: Die Vorteile additiv gefertigter Werkzeuge in der Extrusion
Forschung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist praxisnah und transferorientiert.
Ein Beispiel hierfür ist das Forschungsprojekt ExAM an der Hochschule Schmalkalden (HSM), geleitet
von Professor Stefan Roth, das den Einsatz additiv gefertigter Werkzeuge in der Extrusion untersucht.

Extrusion ist ein kontinuierliches Fertigungsverfahren, bei dem Materialien wie Kunststoffe, Metalle oder Lebens – mittel aufgeschmolzen und durch eine formgebende Düse (Matrize) gepresst werden. So entstehen „endlose“ Produkte wie Schläuche, Rohre oder Folien. Die Anlage besteht typischerweise aus mehreren Komponenten: Das Rohmaterial – meist Kunststoffgranulat – wird über einen Trichter in den Extruder geleitet. Dort fördert eine rotierende Schnecke (oder Schnecken) das Material, wobei Reibung und externe Heizbänder das Granulat aufschmelzen, verkneten und homogenisieren. Die Schmelze wird durch die Düse gepresst, anschließend abgekühlt, kalibriert und schließlich abgelängt oder aufgewickelt.
Entscheidend für die Qualität des Endprodukts sind zahlreiche Parameter: Schneckentyp, Fördergeschwindigkeit, Temperaturführung, Additive sowie die Gestaltung der Werkzeuge. Besonders bei hohen Stückzahlen können Optimierungen entlang der Prozesskette große Effekte erzielen, was Forschung lohnenswert macht.
Additive Fertigung als Innovationsmotor
Traditionell gefertigte Werkzeuge entstehen in subtraktiven Verfahren wie Fräsen oder Drehen, was geometrische Einschränkungen und ungünstige Toträume zur Folge haben kann. Diese führen zu Problemen im Schmelzefluss – etwa Schlieren, Farbabweichungen oder Materialdegradation. Additive Fertigung erlaubt hingegen komplexe, strömungsoptimierte Geometrien, integrierte Kühlkanäle und eine gezielte Temperierung. Ziel ist die homogene, druck- und temperaturgesteuerte Führung der Schmelze durch das Werkzeugentscheidend für Prozessstabilität und Produktqualität. Gerade für Produkte, wie sie typischerweise mittels Extrusion hergestellt werden, sind die Aspekte der Quantität zentral, zeitigen doch die Verbesserungen der Produktion in Folge der hohen Stückzahlen enorme Effekte.

Das Forschungsprojekt ExAM
Hier setzt ExAM an: Das Projekt untersucht, ob sich die bekannten Vorteile der additiven Fertigung auch auf die Extrusion übertragen lassen. Die Konstruktion additiver Werkzeuge eröffnet mehr Freiheitsgrade, was eine präzisere Formgebung und effizientere Schmelzeführung ermöglicht. Zugleich wird im Projekt ermittelt, ob der höhere Entwicklungsaufwand durch wirtschaftliche und technische Vorteile aufgewogen wird.
ExAM ist ein Projekt der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF), gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Es verfolgt eine vorwettbewerbliche Zielsetzung, von der alle beteiligten Unternehmen profitieren können. Die Ergebnisse sollen in einem Leitfaden münden, der Unternehmen praxisorientierte Hilfestellungen bei der Entwicklung additiver Werkzeuge bietet.
Partner und Perspektiven
Drei Partner arbeiten zusammen:
• Die Hochschule Schmalkalden bringt ihre Expertise in Extrusion und Health Tech ein.
• Die Universität Paderborn steuert Kunststofftechnik und technische Konstruktion bei.
• Das Fraunhofer IAPT Hamburg konzentriert sich auf Simulation und additive Fertigung mittels laserbasiertem
Pulverbettverfahren.
An der HSM liegt ein Fokus auf der Bewertung kommerziell verfügbarer Werkzeugstähle für den 3D-Druck. Ziel ist eine möglichst unkomplizierte Integration in bestehende Prozesse. Dabei werden auch Wechselwirkungen innerhalb der Extrusionsanlage berücksichtigt.
Neue Möglichkeiten durch neue Technik
Ein wichtiger Impuls für das Projekt kommt durch die Inbetriebnahme eines neuen 3D-Druckers nach dem Pelletdirektextruderprinzip. Dieser erlaubt die direkte Verarbeitung von Granulaten – auch metallhaltigen sogenannten Feedstocks. Nach dem Druck werden diese gesintert und erhalten die Eigenschaften konventioneller Stähle. Das Verfahren bietet eine wirtschaftliche Alternative zum aufwendigeren Laserschmelzen. Die Anschaffung wurde durch das Thüringer Zentrum für Maschinenbau und EFRE-Mittel der EU unterstützt.
Fazit:
Mit ExAM wird nicht nur erforscht, ob additive Fertigung das Extrusionsverfahren verbessern kann – es wird auch gezeigt, wie praxisnahe Forschung den Technologietransfer beschleunigt. Die Nutzung additiver Werkzeuge in der Extrusion könnte neue Maßstäbe in Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit setzen.
Neue Köpfe
Prof. Dr. iur. Karsten Löw
Anfang März diesen Jahres hat Karsten Löw die Professur für Wirtschaftsrecht, insbesondere dem Recht der Digitalisierung sowie dem Handels und Gesellschaftsrecht, an der Hochschule Schmalkalden übernommen. Seine Schwerpunkte liegen im Unternehmensrecht, dem KI-Recht sowie im Recht der Digitalisierung. Neben seiner einschlägigen wirtschaftswissenschaftlichen Forschungstätigkeit unter anderen in Marburg und Frankfurt am Main konnte er als langjähriger Richter profunde Erfahrungen und Einsichten in die Praxis der Rechtsanwendung sammeln.
Mehr erfahren Sie hier: www.hereingeforscht.de

Aktuelle Forschungsvorhaben
KoReAlt
Entwicklung einer Konstruktionsreferenz zur Beurteilung der Alterung von Kunststoffformartikeln für die Medizintechnik
Projektleiter: Professor Stefan Roth (Fakultät Maschinenbau)

Veranstaltungen
22.10.2025 | 17:00 Uhr – 19:00 Uhr | Audimax
Feierliche Übergabe der Deutschlandstipendien
25.10.2025 | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr | Aula
Antrittsvorlesung Prof. Dr. Karsten Löw (Fakultät Wirtschaftsrecht)
26.–27.11.2025 | Audimax
16. Schmalkalder Werkzeugtagung
Throwback
Live-Demonstrator aus dem Robotics-Lab im Kontext der 6G-Technologie
Im Rahmen der 6G-Plattform-Konferenz in Berlin präsentierte das Forschungsteam von Professor Frank Schrödel einen neu entwickelten Roboter als Live-Demonstrator für das 6G-Terafactory-Projekt. Die Demonstration ermöglichte es den Konferenzteilnehmenden, den rund 120 kg schweren Roboter von Berlin aus fernzusteuern, während sich das Gerät physisch in der 6G-Testumgebung des Unternehmens Adtran in Meiningen befand.
Die Konferenz diente dem wissenschaftlichen Austausch zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der 6G Technologie, insbesondere zur industriellen Anwendung von 6G Kommunikationsstandards. Der vorgestellte Roboter wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts 6G Terafactory vollständig neu konzipiert. Die Forschung konzentriert sich dabei auf den Einsatz robotischer Systeme zur Überwachung und Wartung von Produktionsumgebungen unter Einsatz zukünftiger Kommunikationsinfrastrukturen.
Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt waren die wissenschaftlichen Mitarbeiter Jayabadhrinath Krushnan und Venkata Prashanth Uppalapati. „Seit meinem Start als Forschungsassistent im April 2023 entwickle ich am Robotics-Labor der Hochschule Schmalkalden Roboterlösungen für das 6G Terafactory-Projekt. Der Demonstrator stellt einen wichtigen Meilenstein dar“, so Krushnan. Auch wenn es sich noch um einen Prototyp handelt, plant das Team, die autonome Navigation durch die Integration von ROS 2 (Robot Operating System) weiter auszubauen. Dabei soll der Roboter in die Lage versetzt werden, seine Umgebung zu erfassen und sich eigenständig zu bewegen.